Ich erinnere mich noch gerne an die Serienwelt zu meiner Jugend zurück: „Ein Colt für alle Fälle“ mit der klassischen Episoden-Zahl von 22 oder 23 Folgen je Staffel, oder „Scrubs“ mit 22 bis 25 Folgen (bei den ersten Staffeln), „ALF“ mit 26 Folgen je Staffel, oder „Hör mal, wer da hämmert“ sogar mit 24 bis 28 Folgen je Staffel. Doch dann kamen die Event-Serien, die hochwertig produziert und erzählten Geschichten – irgendwann hat sich’s bei 10 Folgen je Staffel eingependelt, über die eine große Geschichte erzählt wird. Die klassischen Episoden-Serien à la „The Blacklist“ oder „Person of Interest“ mit einem Fall pro Folge – kaum noch auszumachen. Doch dahin soll’s jetzt wieder gehen: Wir stehen möglicherweise vor einer Renaissance, auf die viele Serienfans insgeheim gewartet haben (siehe auch unsere Umfrage hier im Blog); und den Anstoß dazu gibt ausgerechnet jener Anbieter, der qualitativ hochwertige Serien maßgeblich etabliert hat – HBO.

Tja, wer hätte gedacht, dass es sich nochmal in diese Richtung bewegt: In einer Streamingwelt, die sich in den letzten Jahren immer weiter in Richtung „Event-Serie“ bewegt hat – aufwendig, teuer, kurz – wendet sich einer der großen Player nun bewusst ab vom Trend. HBO Max, der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, will künftig wieder verstärkt auf klassische Serienformate setzen. Weg von den zehnteiligen Prestigeproduktionen mit Film-Budget, hin zu Staffeln mit 15, 20 oder gar 22 Folgen – so, wie es einst bei den großen Network-Serien üblich war. Und das ist mehr als ein nostalgischer Impuls. Es ist eine strategische Neuausrichtung, sicherlich auch budgetär getrieben – und, wie ich finde, eine durchaus begrüßenswerte Rückbesinnung auf die Tugenden des seriellen Erzählens. Wie kommt bei HBO auf einmal diese Rückbesinnung zustande? Das liegt vor allem an dem durchschlagenden Erfolg von „The Pitt“, einer Krankenhausserie, die mit ihren 15 Folgen der ersten Staffel bei Emmys und Publikum abräumte. In Deutschland gab’s davon noch nichts zu sehen: Die Erfolgsserie hebt sich HBO offensichtlich als Exklusivtitel für den Start des eigenen Streamingdienstes in Deutschland Anfang kommenden Jahres auf (wir haben hier im Blog darüber berichtet). Ab dann kann man also wieder nostalgisch werden…
Die Rückkehr zum Serienrhythmus der 90er und 2000er
… nostalgisch deswegen, weil die Zeit der langen Staffeln schon eine Weile zurückliegt: In den goldenen Jahren des US-Fernsehens waren Serien nicht etwa Events, sondern feste Begleiter unseres Alltags. Die Staffeln von „Emergency Room“, „LOST“ oder „Roseanne“ und all die polizeilichen und medizinischen Dramen, die bis heute unsere Sehgewohnheiten prägen, bestanden aus mindestens 15, oft sogar 22 Folgen – und zwar pro Jahr. Jede Episode erzählte eine abgeschlossene Geschichte, ein Fall wurde gelöst, die Figuren durchliefen in kleinen Schritten Veränderungen. Diese Struktur ermöglichte es, Beziehungen zu den Charakteren zu entwickeln, Trends und gesellschaftliche Themen an den Zeitgeist anzupassen und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, das auch in digitalen Zeiten seinen Reiz nicht verliert.
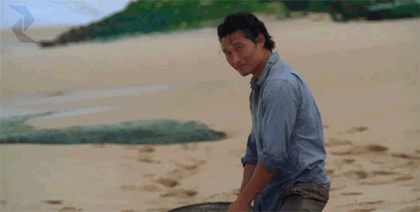
Doch mit dem Erfolg der Streamingdienste, allen voran Netflix, kam die große Veränderung: Plötzlich wurden Staffeln auf wenige Episoden eingedampft, sie erschienen als Blockbuster-Events – oft mit großen Produktionsbudgets und teils jahrelanger Entwicklungszeit. Auch HBO hat sich damit einen Namen gemacht, wie zum Beispiel mit der auch trotz der geringen Episodenzahl sehr dicht erzählten Serie „The Newsroom“. In den letzten Jahren ist es üblich geworden, dass Streaming-Dienste zwei- oder dreijährige Pausen zwischen den Staffeln einlegen oder Staffeln selbst in mehrere Teile geteilt werden (man denke nur an „Stranger Things“), und diese Staffeln enthalten in der Regel nur sehr wenige Folgen, was zuletzt auch zu Kritik beim Publikum an Streamingdiensten zum Umgang mit Serien wie „Wednesday“, „House of the Dragon“ und eben „Stranger Things“ geführt hat.

Serien am Stück nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch zu schauen, das kennen wir seitdem als „Binge-Watching“. Ich war nie ein Fan davon, weil für mich die Nähe zur Serie und ihren Figuren dabei Stück für Stück verloren ging. Man konsumierte, statt zu (er)leben, was Woche für Woche auf dem Bildschirm passierte. Klar, Geschmäcker sind verschieden, es gibt Pro- und Contra-Haltungen, wir haben das auch hier im Blog an mehreren Stellen oft kontrovers diskutiert. „The Pitt“ scheint jetzt zu beweisen, dass ein „besseres“ Format und damit Veröffentlichungsmodell nicht nur existiert, sondern auch in der heutigen Fernsehlandschaft nach wie vor funktionieren kann, wie es zum Beispiel Jeff Dodge bei ScreenRant einschätzt.
Eine persönliche Betrachtung – Kind der Seriengeneration
Als Serienfan der 90-er bin ich mit genau diesen Formaten groß geworden. Es war normal, dass eine Staffel 22 Folgen oder mehr hatte und Woche für Woche neue Abenteuer der Lieblingsfiguren warteten. Man fühlte sich wie ein Teil der Familie, wie bei den Conners zum Beispiel (habe ich hier im Abschiedsbeitrag zur Serie „The Conners beschrieben), bei den Taylors oder natürlich bei den Beimers. Das tolle an dieser alten Serienlogik: Je mehr Episoden pro Jahr, desto mehr wird eine Serie zum eigenen Begleiter, zur Routine, die durch Höhen und Tiefen führt. Die jahrelange Entwicklung von Beziehungen und Geschichten, die kleinen Veränderungen, die manchmal erst in späteren Staffeln zum Tragen kommen, machen für mich den Reiz guter Unterhaltung aus.

HBO Max setzt jetzt bewusst auf „mehr statt weniger“
Die Erkenntnis, dass die üppigere Episoden-Zahl mehr Bindung zwischen Serien-Charakteren und Publikum schaffen kann, scheint nun bei Warner Bros. Discovery und HBO Max angekommen zu sein. „Wir starten in eine neue Ära des Serienfernsehens“, erklärt Sarah Aubrey, Leiterin der Eigenproduktionen bei HBO Max, im Interview mit Deadline, „unser Ziel ist es, einen Teil der Dynamik, die das Network-Fernsehen geprägt hat, ins Streaming zu bringen. Längere Staffeln bedeuten mehr Raum für Storytelling und Charakterentwicklung, sie machen Serien wieder zum festen Bestandteil des Alltags der Zuschauer.“ Das gilt nicht nur jetzt schon für das Erfolgsmodell „The Pitt“, sondern in Zukunft wohl auch für kommende Projekte wie „American Blue“ (ein Polizeidrama von Jeremy Carver) und „How To Survive Without Me“ (Arbeitstitel eines Familiendramas unter Führung des großen Greg Berlanti), deren Pilotfolgen gerade entstehen; aber dazu später mehr.
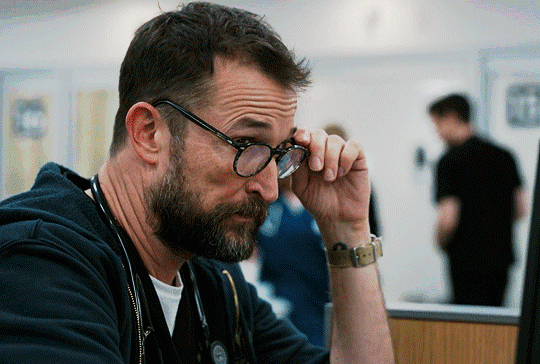
Dass HBO Max nun gezielt Serien entwickelt, deren Staffeln 15 oder sogar 22 Folgen umfassen, ist eine bewusste Abkehr vom Prestige-Modell. Auch beim Budget wird die Strategie angepasst – und das ist gefühlt der eigentliche Treiber aus meiner Sicht: Statt 10 Millionen Dollar wie bei manchen Star-Projekten sollen die neuen Serien mit rund 4 Millionen Dollar pro Folge auskommen – was nicht nur mehr Episoden ermöglicht, sondern kreativen Spielraum schafft für Diversität bei den Inhalten und eine größere Zahl an Produktionen pro Jahr: „Unser Anspruch ist ein ambitioniertes Storytelling. Wir nehmen uns Zeit bei der Entwicklung, verzichten aber auf starre Regeln. Es geht nicht darum, massenhaft Piloten zu produzieren und wahllos auszuwählen, sondern gezielt die besten Drehbücher und Ideen weiterzuführen. Das Modell von ‚The Pitt‘ zeigt, wie man mit einer längeren Staffel, schlankeren Produktion und klugem Casting einen Publikumsliebling schafft“, erklärt Sarah Aubrey weiter.
„The Pitt“: Ein neuer Maßstab für Serientradition und Realismus
Der Erfolg von „The Pitt“ ist dabei so etwas wie der Prüfstein dieser neuen alten Strategie. Die Krankenhausserie erzählt über 15 Episoden hinweg einen einzigen Tag in der Notaufnahme – ein dramaturgischer Kniff, der die Handlung intensiv und dicht macht. Noah Wyle, bekannt aus „ER“, übernimmt als Oberarzt Dr. Michael „Robby“ Robinavitch nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch Co-Produzent. „The Pitt“ punktet aber nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Kritikern: Emmy-Gewinne für Wyle als Hauptdarsteller und Katherine LaNasa als Stationsschwester Dana Evans sowie zahlreiche weitere Nominierungen sprechen eine klare Sprache. Besondere Wertschätzung erfährt im Übrigen die Rückkehr zum klassischen wöchentlichen Ausstrahlungsmodell, das Fans als „das gute alte Fernsehen“ feiern. Es wird also NICHT alles in einer Nacht zum Binge bereitgestellt, sondern Episode für Episode zelebriert. Bei den Emmys wurde als ein Grund, warum „The Pitt“ so begeistert, der Realismus und die Intimität der Geschichten angeführt: Man lebt mit den Figuren, man leidet mit ihnen, und weil jede Woche eine neue Folge kommt, ist das Serienerlebnis intensiver als das Binge-Konsumieren. Oder wie es HBO-Chef Casey Bloys gegenüber The Wrap formuliert, habe „The Pitt“ gezeigt, dass man auch zu der Formel zurückkehren kann, „die über Jahrzehnte perfektioniert wurde, indem man mehr als 10 Folgen produziert … und eine Serie etabliert, die jährlich zurückkehren kann, was ein wirklich wichtiger Teil des Fernsehens war: für die Zuschauer und Fans da zu sein, um regelmäßig Zeit mit den Charakteren zu verbringen.“
Die nächsten Projekte stehen in den Startlöchern: „American Blue“ und „How To Survive Without Me“
Die nächsten neuen Serien folgen dem erprobten Modell: Zwei Produktionen stehen dabei wie gesagt im Fokus. „American Blue“ ist ein Polizeidrama von Jeremy Carver („Supernatural“), das sich thematisch an Serienhits wie „Hill Street Blues“ (hab‘ ich früher immer gerne geschaut) und „NYPD Blue“ orientiert. Im Mittelpunkt steht Brian „Milk“ Milkovich, der in seine Heimatstadt Joliet zurückkehrt, um eine angeschlagene Polizeiabteilung zu retten – mit reichlich Gelegenheit für Figurenentwicklung und Episodenstruktur. Die Macher ließen sich bei der Stoffentwicklung sogar direkt von den Polizisten vor Ort inspirieren, heißt es bei Warner.
Das Familiendrama „How To Survive Without Me“ stammt von Erfolgsproduzent Greg Berlanti („You“, „Arrowverse“) sowie Bash Doran und Robbie Rogers – auch hier geht es um die Herausforderung der Identitätsfindung und den Spagat zwischen individuellen und familiären Ansprüchen. Die Produktion ist Teil eines neuen Rahmenvertrags mit Warner Bros. Television, und die Serie wird ebenfalls mindestens 15 Folgen pro Staffel umfassen – solange die Pilotfolgen und deren Qualität überzeugen, verspricht Aubrey: „Unser Ziel ist es, den Workflow so zu gestalten, dass wir mehrere große Serien jährlich an den Start bringen können, ohne auf die Tiefe und Qualität zu verzichten, die HBO seit Jahrzehnten auszeichnet.“
Was bleibt von der alten HBO-Max-DNA?
Müssen sich Fans der großen Serien-Events jetzt Sorgen machen? Nein, denn HBO Max und das klassische HBO trennen sich nicht von ihren prestigeträchtigen Großformaten. Im Januar 2026 steht das Fantasy-Highlight „A Knight of the Seven Kingdoms“ als „Game of Thrones“-Prequel-Serie mit sechs Folgen in der ersten Staffel an (wir haben hier darüber berichtet), und die lang erwartete „Harry Potter“-Serie folgt ebenfalls (geplant ab 2027, mit zehn Staffeln über zehn Jahre, mehr dazu hier im Blog). Sender und Streamingdienst bleiben also Heimat für Event-Serien, aber die strategische Öffnung für breitenwirksame Serientradition ist für meinen Geschmack sehr augenfällig.

Der Wechsel am deutschen Markt und die Erwartungen der Fans
Für den deutschen Serienmarkt fällt die Entscheidung zusammen mit dem Start von HBO Max: Der Streamingdienst startet – endlich, wie viele Serienfans sicher sagen – nach mehreren Verzögerungen im Januar 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bekanntlich liefen bislang HBO-Originals vor allem exklusiv bei Sky/WOW, doch nun scheint diese Ära zu enden. Der Dienst tritt mit einem umfassenden Angebot an und dürfte, mit den exklusiven Warner-Inhalten (inklusive Olympischen Winterspielen), direkt als Mitbewerber auf dem Streamingmarkt wirken – sicher mit deutlich Aufholbedarf zu Netflix und Disney+, weil man einfach so spät dran ist, aber vermutlich schnell in Nähe von Apple TV und Paramount+. Und dann bleibt zu hoffen, dass das neue alte Serienmodell wieder Schule macht.
Bilder: HBO
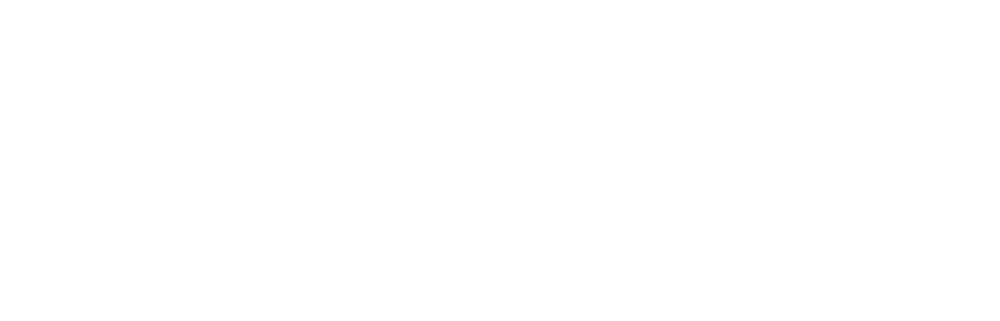



















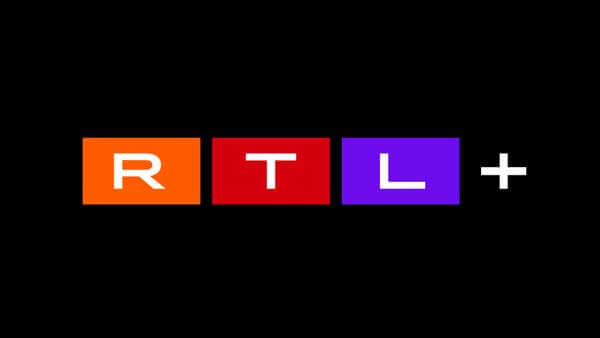



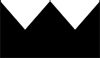













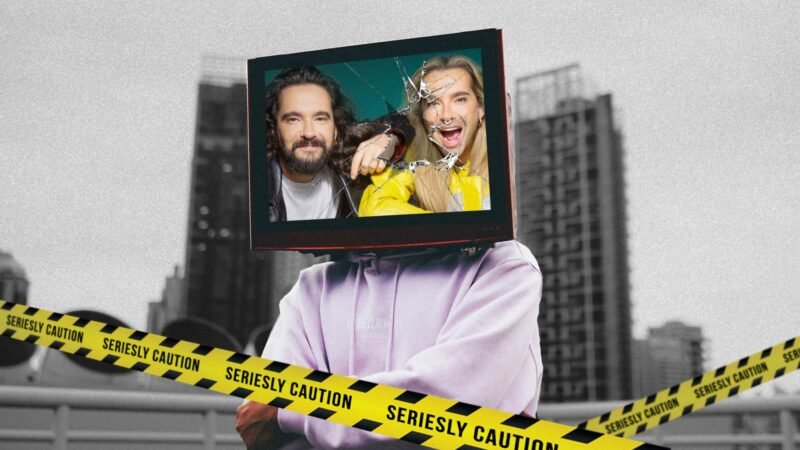

Als Star Trek-Fan ist das ja etwas, was die Fan-Riege schon seit geraumer Zeit wieder fordert: Ich brauche keine dicken, kinoreifen Effekte, sondern gute Geschichten – und davon möglichst so viele, dass ich mit den Figuren zusammenwachsen kann.
Wenn, wie bei Strange New Worlds zuletzt, du pro Staffel nur 10 Episoden hast, hast du im Grunde nichts, was dich überraschen kann – du kannst nicht experimentieren. Die gute alte „Füller-Episode“ war nichts Schlechtes; im Gegenteil – oft waren es gerade die Episoden, die Fans und Serie näher zusammen gebracht haben.
Stranger Things hat in 10 Jahren 40 Episoden zusammengebracht – das waren früher 2 Jahre. 😂
Ich steige bei vielen Serien aus, einfach weil ich nicht 3 Jahre auf eine neue Staffel warten will. So gut hab‘ ich die Figuren ja am Ende dann auch nicht gekannt.
Es gibt für die „Mini-Serien“ nach wie vor einen Platz. Wie hätte „24“ in 8 Folgen erzählt werden sollen? 😅
Trackbacks